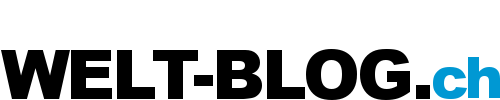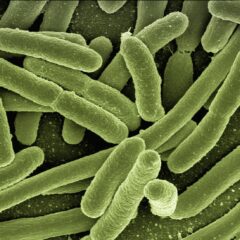Co2-Emissionen: Alternative Herstellung von Paracetamol – mit Bakterien und Plastikflaschen
Das bekannte Schmerzmittel Paracetamol wurde bisher in erster Linie aus Erdöl gewonnen. Jetzt haben Forscherinnen und Forscher einen Weg gefunden, das Medikament umweltfreundlicher herzustellen – mit Bakterien, die dazu Plastikmüll verwerten. Darmbakterien als Problemlöser Akademikern der University of Edinburgh ist es gelungen, einen Weg für die Herstellung von Paracetamol zu finden, der völlig ohne Erdöl und CO2-Emssionen auskommt – die Fachzeitschrift „Nature Chemistry“ hatte zuerst darüber berichtet. Die Forscher fanden heraus, das eine bestimmte chemische Reaktion – der sogenannte Lossen-Abbau – auch unter Bedingungen herbeigeführt werden kann, die biokompatibel sind. Normalerweise wäre der klassische Lossen-Abbau für Escherichia coli-Darmbakterien (E. coli) zu hart, um sie für den Abbau von PET-Plastikmüll zu verwenden. Aber das Forscherteam aus Schottland fand heraus, dass Phosphat im Innern der Bakterien als Katalysator bei milden Temperaturen funktioniert. Das ermöglicht eine nicht-biochemische Reaktion in einer lebenden Zelle. Umwandlung in Paracetamol Wichtiger Bestandteil dieser Reaktion ist Terephthalsäure, die chemisch einem Grundbestandteil von PET ähnelt. Das inspirierte die Forscherinnen und Forscher dazu die Terephthalsäure aus der Hydrolyse alter PET-Flaschen zu gewinnen. Präparierte E.-coli-Stämme konnten daraufhin mithilfe der veränderten Terephthalsäure durch den Lossen-Abbau Para-Aminobenzoesäure (Paba) produzieren, den die E.-coli-Bakterien zum Wachstum benötigen. Nachdem das Forscherteam einem E.-coli-Stamm ein Gen aus einem Pilz und einem anderen Stamm ein weiters Gen aus einem Bakterium eingepflanzt hatten, fingen die aus diesen Genen abgeleiteten Enzyme an, Paba in Paracetamol umzuwandeln. Paracetamol-Ertrag von 92 Prozent Nachdem die schottischen Forscherinnen und Forscher den Prozess weiter optimierten, konnte der Paracetamol-Ertrag von anfänglich 29 Prozent auf 92 Prozent des ursprünglichen Substrats gesteigert werden. Dabei wird für den ganzen Prozess nur ein Gefäss benötigt, was für die industrielle Fertigung von Vorteil ist. Die kommerzielle Produktion des so gewonnenen Paracetamols ist nun der nächste Schritt. Er beweist das enorme Potenzial, welches die technische Biologie besitzt, um von fossilen Stoffen loszukommen, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu kreieren und nachhaltige Chemikalien zu entwickeln. Bildnachweis: Pixabay, 123081,...
Nachhaltige Freiluftprojekte: Materialien, Energieversorgung und Umweltverträglichkeit im Fokus
Nachhaltige Freiluftprojekte gewinnen zunehmend an Bedeutung – sei es im Rahmen von Firmenevents, öffentlichen Veranstaltungen oder temporären Installationen im Aussenbereich. Der Anspruch, ökologische Verantwortung mit funktionaler Planung zu vereinen, erfordert nicht nur kreative Lösungen, sondern auch ein tiefes Verständnis für Materialien, Energieversorgung und Umweltverträglichkeit. Wer solche Vorhaben professionell umsetzt, steht vor komplexen Herausforderungen: Wie lassen sich Ressourcen schonen, ohne die Stabilität oder Sicherheit zu gefährden? Welche Infrastrukturkomponenten sind geeignet, um unabhängig von festen Versorgungsnetzen zu agieren? Und inwiefern können Umweltauflagen nicht nur erfüllt, sondern aktiv in ein nachhaltiges Gesamtkonzept integriert werden? Wir richten uns an erfahrene Planer, Projektverantwortliche und Entscheidungsträger, die nachhaltige Freiluftprojekte auf einem hohen fachlichen Niveau umsetzen wollen. Dabei werfen wir einen differenzierten Blick auf den gezielten Materialeinsatz, moderne Energieoptionen sowie gesetzliche und ökologische Rahmenbedingungen. Umweltschonende Materialien gezielt auswählen: Worauf es bei Bodenbelägen, Zelten und Mobiliar ankommt Bei der Auswahl der Materialien für nachhaltige Freiluftprojekte steht nicht nur die Langlebigkeit im Vordergrund, sondern auch deren Umweltbilanz über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Bodenbeläge sollten möglichst aus recycelbaren oder nachwachsenden Rohstoffen bestehen, die zugleich stabil genug für intensive Nutzung sind. Hier bieten sich etwa modulare Bodenplatten aus recyceltem Kunststoff oder Naturmaterialien wie Bambus an. Diese lassen sich mehrfach verwenden, sind leicht zu transportieren und verursachen in der Entsorgung kaum Probleme. Zelte und Überdachungen sollten aus PVC-freien, schadstoffarmen Membranen gefertigt sein. Polyester mit Beschichtungen auf Silikonbasis oder biologisch abbaubare Varianten können hier eine zukunftsfähige Alternative darstellen. Achten Sie bei der Auswahl des Mobiliars auf FSC-zertifiziertes Holz oder Aluminium mit hohem Recyclinganteil – beides Materialien, die nicht nur ökologisch überzeugen, sondern sich auch ästhetisch hochwertig in professionelle Settings integrieren lassen. Neben der Materialart spielt die Möglichkeit der Demontage und Wiederverwertung eine wichtige Rolle. Konstruktionen, die werkzeuglos montiert werden können, reduzieren nicht nur den Zeitaufwand, sondern auch das Risiko unnötiger Beschädigungen. Energieautarke Freiluftkonzepte: Mobile Lösungen für Strom- und Wasserversorgung im Gelände Eine nachhaltige Energieversorgung ist zentraler Bestandteil jeder verantwortungsvoll geplanten Outdoor-Veranstaltung. Mobile Solaranlagen zählen mittlerweile zur Basisausstattung vieler Projekte. Sie liefern emissionsfreien Strom und lassen sich flexibel skalieren – vom kleinen Panel auf dem Technikzelt bis zur grossflächigen Solarfeldlösung für Bühnen und Cateringbereiche. Kombiniert mit leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akkus, lässt sich eine durchgängige Versorgung auch bei wechselhafter Sonneneinstrahlung gewährleisten. Für die temporäre Wasserversorgung empfiehlt sich der Einsatz mobiler Filtersysteme. Diese ermöglichen es, vorhandenes Regen- oder Brunnenwasser aufzubereiten und für Sanitäranlagen oder Reinigungszwecke nutzbar zu machen. Der Vorteil liegt nicht nur in der Ressourcenschonung, sondern auch in der Unabhängigkeit von externen Leitungsnetzen. Biokraftstoffbetriebene Generatoren bieten eine ergänzende Option, sollten aber ausschliesslich als Rückfallebene bei extremen Verbrauchsspitzen zum Einsatz kommen. Durch intelligente Laststeuerung – beispielsweise via Smart Grid-Komponenten – lassen sich Verbrauchsprofile optimieren und überschüssige Energie...
Die EU plant den Verbrauch von Plastiktüten zu reduzieren
Die EU-Länder dürfen in Zukunft Plastiktüten verbieten bzw. besteuern. Ziel ist die drastische Reduzierung des Verbrauchs an Plastiktüten. Einige Supermärkte, Drogerien oder Einzelhändler haben bereits reagiert. Der weltweite Verbrauch an Plastiktüten ist erschreckend hoch. So werden jährlich beispielsweise in Portugal, Polen und Bulgarien über 450 Plastiktüten pro Kopf verbraucht. Deutschland liegt mit etwa 70 Plastiktüten pro Kopf und Jahr deutlich besser im europäischen Schnitt. Laut Angaben des EU-Parlaments werden in der gesamten EU jährlich 100 Milliarden Plastiktüten verwendet. Das Schlimme daran: Etwa zehn Prozent dieser Tüten werden achtlos weggeworfen und geraten über den Wind bis in die Weltmeere, wo sie auf der Wasseroberfläche schwimmen. Sogenannte Müllteppiche aber bergen große Gefahren für die Tierwelt. Vögel, Fische oder Schildkröten verfangen sich schnell in solchen Plastiktüten oder fressen den giftigen Werkstoff, da sie ihn für Futter halten. In der Nordsee enthalten ganze 94 Prozent der Vogelbäuche Plastik. Nun also sind wir dran. In Brüssel einigten sich im November 2014 Vertreter der 28 Mitgliedländer auf einen Gesetzesentwurf, der nun endlich abgesegnet wurde. Bis Ende 2025 soll jeder Bürger der EU-Staaten maximal 40 Plastiktüten pro Jahr verbrauchen. Sinnvolle Maßnahmen Doch wie soll das funktionieren? Zum einen sollen die Menschen stärker zur Kasse gebeten werden. So sollen künftig wie schon im Supermarkt auch im Einzelhandel Centbeträge für Plastiktüten verlangt werden. Des Weiteren stellten bereits viele Supermärkte Papiertüten für einen kleinen Betrag als ihr Plastik-Pendant zur Auswahl. Außerdem wurden in vielen Drogeriemärkten kleine kostenfreie Plastiktüten aus dem Sortiment genommen. Es scheint, als zögen wir alle an einem Strang – gemeinsam für die Umwelt! Foto: Thinkstockphotos, iStock,...
Umwelt: Neue Regeln seit dem 1. September
Seit gestern gibt es zum Schutz der Umwelt neue Richtlinien für Autos und Staubsauger. Wir dürfen uns also über mehr Transparenz durch Umwelt-Etiketten freuen und über wenige Rußpartikel in unserer Luft. Umwelt-Etiketten für Staubsauger Seit dem 1. September 2014 sollen wir nun leichter erkennen, ob der gewünschte Staubsauger ein Stromfresser ist oder nicht. Wie wir es bereits von Kühlschränken, Waschmaschinen oder Wäschetrocknern kennen, sollen Staubsauger mit Etiketten versorgt werden, die Auskunft über Stromverbrauch, Saugkraft und Lautstärke geben. Zudem gibt es eine neueingeführte Obergrenze für den Energiebedarf von 1600 Watt. Aber keine Sorge, Sie dürfen Ihren derzeitigen Sauger behalten und auch weiterverkaufen. Nur beim Neukauf im Laden haben Sie nun die Auswahl zwischen verschiedenen Modellen mit neuen Etiketten. Die Schadstoffklasse Euro 6 ist da Seit gestern gibt es auch für Neuwagen eine neue Richtlinie. So ist die Schadstoffklasse „Euro 6“, über die nun schon seit Monaten diskutiert wird, endlich verbindlich. Der zugelassene Stickoxid Wert sinkt für einen Benzinmotor auf maximale 60 Milligramm pro Kilometer, beim Dieselmotor auf 80 Milligramm. Damit haben sich die Werte im Vergleich zur Euro 5-Norm halbiert. Außerdem reduziert sich bei Dieselmotoren die zugelassene Menge an Rußpartikeln auf 4,5 Milligramm. Aber auch hier gelten die Regeln nur für Neuwagen ab dem 1. September 2014. Für die Umwelt freuen wir uns trotzdem!...
Plastikmüll in den Weltmeeren: Hoffnung auf Besserung?
Das größte Verhängnis für Meeresbewohner ist vielen Menschen noch immer nicht bewusst: Plastik. Zum Beispiel im Frühjahr 2012 verendete an der andalusischen Küste ein Pottwal kläglich – in seinem Bauch fand man 17 Tonnen Plastik. Bislang gingen Forscher davon aus, dass sich insgesamt mehr als 100 Millionen Tonnen des Kunststoffes in den Weltmeeren angesammelt haben – Tendenz steigend. Nun macht eine Studie der University of Western Australia aber ein bisschen Hoffnung. Das Problem: Viele Meeresforscher sind besorgt: Sie befürchten ganze Inseln aus Plastikmüll – bis zu 100 Millionen Tonnen – in den Ozeanen, die das Leben von Fischen, Seevögeln oder Kleinstorganismen nachhaltig bedrohen. Das Problem: In den Meeren hält sich Plastik sehr lange – bis zu 450 Jahre dauert es, bis sich zum Beispiel eine PET-Flasche vollständig zersetzt hat. Auf dem Weg dorthin wird sie durch die UV-Strahlung in gefährliche Mikropartikel gespalten, deren Durchmesser unter einem Millimeter liegt. Dadurch wird der Kunststoff besonders gefährlich für die Meeresbewohner, da sie diese auf natürlichem Wege durch das Wasser aufnehmen. Dabei ist es nicht unbedingt nur Müll von den Stränden, der in die Weltmeere gelangt – durch die lange Haltbarkeit des Kunststoffs kann dieser über Jahre hinweg durch den Wind in das Meer getrieben werden. Nur eine geringe Menge wird anschließend wieder an den Strand gespült – ein Teil sinkt sofort an den Meeresgrund, der größte Teil des Unrats wird jedoch auf das offene Meer getrieben. Hoffnung oder besorgniserregende Erklärung? Die besorgniserregenden Zahlen wurden belegt durch eine Untersuchung von verendeten Meeresvögeln – das erschreckende Ergebnis: 96 Prozent von ihnen hatten Plastik im Magen. Die Müllteile blockieren dabei den Magen-Darm-Trakt der Tiere und somit kann keine weitere bzw. nur sehr wenig Nahrung aufgenommen werden. Ein wenig Hoffnung auf die Besserung des Problems macht aber nun eine Studie von der University of Western Australia. Die Forscher werteten 3.000 Oberflächenproben von 141 verschiedenen Orten weltweit aus – und fanden deutlich weniger Mikroplastik als anzunehmen wäre. Zwar wurden in 88 Prozent der Proben Plastikteile gefunden, jedoch in einer sehr geringen Konzentration. Entwarnung kann man nun aber leider noch nicht geben: Die erschreckendste Erklärung ist wohl, dass sich all die vermuteten Partikel bereits in den Körpern der Meeresbewohner befinden. Eine andere Erklärung wäre, dass sich an dem an der Oberfläche befindlichen Mikroplastik Kleinstorganismen festgesetzt haben. Dadurch wird es schwerer und sinkt in tiefere Wasserschichten ab. Blick für wertvolle Ressourcen schärfen Doch egal, woran die geringe Konzentration nun wirklich liegt: Die Forscher sind sich einig, dass gegen die globale Bedrohung durch Kunststoff in den Meeren dringend etwas getan werden muss. Man spricht sich zum Beispiel für Recycling-Initiativen aus, die den Blick für die eigentlich wertvolle Ressource Plastikmüll schärfen...
Das Freihandelsabkommen mit den USA: Was das TTIP für Verbraucher und Umwelt bedeutet
Seit Juli 2013 verhandeln die USA und die Europäische Union über die Einrichtung einer Freihandelszone. Dieses transatlantische Handels- und Investitionsabkommen (TTIP) soll die Standards in nichthandelspolitischen Bereichen vereinheitlichen. Werden diese Standards dann nicht erfüllt, können Handelssanktionen verhängt oder gigantische Entschädigungen für die Unternehmen fällig werden, wie es bereits durch andere Abkommen geschehen ist. 2015 soll das TTIP unterschriftsreif sein. Welchen Nutzen hat Europa? Bereits seit den 90er Jahren wurde immer wieder über eine Freihandelszone zwischen den Vereinigten Staaten und Europa diskutiert. Damit soll das Wirtschaftswachstum beider Seiten verbessert und die Arbeitslosigkeit gesenkt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel oder auch José Manuel Barroso zählen zu den Befürwortern. Gleichzeitig wird das geplante Abkommen massiv kritisiert. Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen warnen vor den Folgen und haben dabei auch viele Politiker auf ihrer Seite. Die zu erwartenden positiven Effekte seien für die Bevölkerung sehr gering. Neu entstehenden Arbeitsplätzen stünden Verluste bei kleineren, vor allem ökologischen, Landwirtschaftsbetrieben gegenüber. Der Agrarbericht 2014 vom Agrarbündnis deutscher Organisationen aus Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz äußert sich ebenfalls sehr kritisch gegenüber dem TTIP. Standards werden nach unten angeglichen Gravierende negative Auswirkungen würde es auf Umwelt, Gesundheit und Arbeitnehmerrechte geben. Da gemeinsame, „harmonisierte“ Standards auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner beschlossen würden, bedeute dies für viele Einzelstaaten eine Verschlechterung der bisher geltenden Standards. Handelshemmnisse gibt es aus europäischer Sicht schon jetzt kaum. Die Zölle zwischen den USA und der EU liegen sehr niedrig. Profiteure eines Handelsabkommens sind daher vielmehr unter amerikanischen Konzernen und Finanzinvestoren zu erwarten. So wollen diese Kennzeichnungspflichten für gentechnisch veränderte Lebensmittel oder das Verbot des Einsatzes von Wachstumshormonen bei Schlachttieren kippen. Wer genau für die Vertragspartner verhandelt ist nicht bekannt. Auch die konkreten Inhalte werden größtenteils geheim gehalten, selbst vor den einzelnen Parlamenten der EU-Staaten. Dies befeuert natürlich Befürchtungen, dass mit dem TTIP hauptsächlich Privilegien von Konzernen und Investoren geschaffen werden, auf Kosten demokratisch erarbeiteter Standards und Rechte der Verbraucher. Gewinnmaximierung vor Nachhaltigkeit Während in Europa das Vorsichtsprinzip bei Lebensmitteln gilt, ist dies in den USA nicht der Fall. Dort muss die Unbedenklichkeit von gentechnisch verändertem Getreide oder „Chlorhühnchen“ nicht nachgewiesen werden, bevor es in den Handel gelangt. Die Landwirtschaft ist für knapp die Hälfte des weltweiten Kohlendioxid-Ausstoßes verantwortlich. Die direkten und indirekten Folgen eines transatlantischen Handelsabkommens sind also äußerst weitreichend und brauchen daher eine offene und transparente Diskussion mit Vor- sowie Nachteilen für alle Beteiligten....