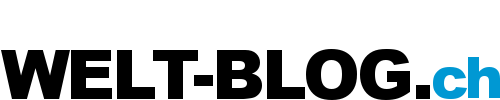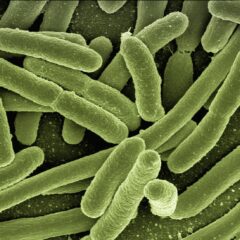Schweizer Kantone: Zwischen Wirtschaftswachstum und Defiziten
Der wirtschaftliche Zustand der Schweizer Kantone präsentiert sich 2025 äusserst vielschichtig. Während einige Regionen robust wachsen oder Überschüsse verbuchen, kämpfen andere mit Defiziten und strukturellen Herausforderungen. Die Kantone haben im laufenden Jahr ihre Budgets für 2025 vorgelegt – knapp die Hälfte rechnet mit roten Zahlen, während die übrigen Kantone positive Resultate verzeichnen. Zug und Basel-Stadt mit höchstem BIP Besonders stechen Zürich, Zug und Basel-Stadt durch ihre hohe Wettbewerbsfähigkeit und über dem Schweizer Durchschnitt liegenden Bruttoinlandsprodukten (BIP) hervor. Zürich führt das nationale Ranking mit einem BIP von rund 165 Milliarden Franken an, Basel-Stadt glänzt mit dem höchsten BIP pro Kopf und einem grossen Handelsbilanzüberschuss von über 47 Milliarden Franken. Die kantonale Steuerpolitik, innovative Unternehmen und ein diversifizierter Arbeitsmarkt tragen in diesen Regionen wesentlich zur Stabilität bei. Dazu gehören auch Zug und Aargau, die langfristig die besten Wachstumsaussichten besitzen. Steigende Ausgaben belasten viele Kantone Demgegenüber sehen sich Kantone wie Waadt und Bern mit beträchtlichen Defiziten konfrontiert. Der Kanton Waadt erwartet für 2025 ein Minus von 303 Millionen Franken – das höchste Defizit seit einem Vierteljahrhundert. Bern konnte in diesem Jahr zwar einen Überschuss erzielen, leidet aber traditionell unter schwächerem Wachstum als die Wirtschaftszentren. Auffällig ist, dass die Ausgaben im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich in vielen Kantonen zuletzt deutlich gestiegen sind. Diese Bereiche bilden mit Abstand die grössten Brocken in den Haushalten, insbesondere vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung und wachsender sozialer Anforderungen. Neue Schulden für Investitionen Ein weiteres Problem sind die teils unsicheren Gewinnausschüttungen der Nationalbank, welche die kantonalen Budgets beeinflussen und den Spardruck erhöhen. Ausserdem erfordern Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur oft neue Schuldenaufnahme. Die Steuerpolitik bleibt ein Mittel zur Standortsicherung: Einige Kantone wie Bern und Neuenburg planen Steuersenkungen; Thurgau zieht hingegen Steuererhöhungen in Erwägung. Unterschiedliche kantonale Entwicklungen Die volkswirtschaftliche Entwicklung verläuft kantonal unterschiedlich. Laut dem Swiss Reco Index wuchsen die Wirtschaftszahlen im Sommer insbesondere in Basel-Stadt, Genf und Zürich mit 1,3 bis 1,8 Prozent, während Waadt und Bern einen Rückgang verzeichneten. Die Bergkantone und einige Grenzregionen kämpfen naturgemäss mit geringeren langfristigen Wachstumsperspektiven und geringem BIP pro Kopf, etwa Jura, Graubünden und Wallis. Bildnachweis: Pixabay, 867162,...
Der digitale Wandel: Smartphones als neue Kassenlösung
In einer Welt, die sich immer mehr in Richtung Digitalisierung bewegt, ist es kein Wunder, dass auch der Zahlungsverkehr eine Transformation durchläuft. Smartphones übernehmen zunehmend die Rolle von POS-Terminals, und das nicht nur in grossen Unternehmen, sondern auch in kleinen, nachhaltigen Betrieben. Diese Entwicklung ist nicht nur technologisch spannend, sondern auch ein Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren und benutzerfreundlicheren Zukunft. Die Rolle von Smartphones in der modernen Zahlungstechnologie Smartphones sind längst mehr als nur Kommunikationsgeräte. Sie haben sich zu leistungsfähigen Alleskönnern entwickelt, die in der Lage sind, komplexe Aufgaben zu bewältigen, zu denen auch das Abwickeln von Zahlungen gehört. Die Möglichkeit, ein Smartphone als POS-Terminal zu nutzen, bietet zahlreiche Vorteile. Durch die Integration von NFC-Technologie und speziellen Apps können Transaktionen schnell und sicher verarbeitet werden. Diese Technologie ist besonders für kleine und mittlere Unternehmen attraktiv, die sich teure Kartenlesegeräte nicht leisten können oder wollen. Ein weiterer Vorteil besteht in der Portabilität. Ein Smartphone ist leicht und kann problemlos überall hin mitgenommen werden, was es ideal für Unternehmen macht, die auf Märkten, Messen oder Pop-up-Events tätig sind. Diese Flexibilität erlaubt es Unternehmern, ihre Dienstleistungen und Produkte ohne grossen Aufwand an verschiedenen Orten anzubieten. Smartphones sind kostengünstiger als herkömmliche POS-Systeme Sie ermöglichen den Einsatz von modernen Technologien wie NFC Kompatibilität mit verschiedenen Zahlungsmethoden, einschliesslich digitaler Wallets Nachhaltigkeit und Technologie: Eine Symbiose Nachhaltigkeit ist in der modernen Geschäftswelt nicht mehr nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit. Unternehmen, die auf umweltfreundliche Praktiken setzen, profitieren nicht nur von einem besseren Image, sondern tragen auch aktiv zum Schutz unseres Planeten bei. Die Nutzung von Smartphones als POS-Terminals passt perfekt in dieses Bild. Zum einen reduziert der Einsatz von Smartphones den Bedarf an zusätzlichen Geräten. Die Produktion von elektronischen Geräten ist ressourcenintensiv, und indem ein Smartphone mehrere Funktionen übernimmt, werden Ressourcen gespart. Zudem sind Smartphones in der Regel energieeffizienter als herkömmliche Kassensysteme, was zu einem geringeren Energieverbrauch führt. Ein weiterer Punkt ist die Reduzierung von Papierabfällen. Durch die Digitalisierung von Belegen und Rechnungen wird der Bedarf an Papierbelegen minimiert. Kunden können ihre Quittungen per E-Mail oder App erhalten, was nicht nur umweltfreundlicher ist, sondern auch die Verwaltung und Nachverfolgung von Transaktionen erleichtert. Kundenfreundlichkeit und Sicherheit Die Nutzung von Smartphones als POS-Terminals bringt auch zahlreiche Vorteile für die Kunden mit sich. Die Bezahlung per Smartphone ist schnell und unkompliziert. Kunden können ihre Einkäufe mit einem einfachen Tap oder Scan abschliessen, was den Bezahlvorgang erheblich beschleunigt. Sicherheit ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Moderne Zahlungstechnologien bieten eine hohe Sicherheit durch Verschlüsselung und Authentifizierungsmethoden wie Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung. Diese Sicherheitsmassnahmen sorgen dafür, dass sowohl die Daten der Kunden als auch die der Unternehmen geschützt sind. Zudem sind digitale Zahlungen oft...
Co2-Emissionen: Alternative Herstellung von Paracetamol – mit Bakterien und Plastikflaschen
Das bekannte Schmerzmittel Paracetamol wurde bisher in erster Linie aus Erdöl gewonnen. Jetzt haben Forscherinnen und Forscher einen Weg gefunden, das Medikament umweltfreundlicher herzustellen – mit Bakterien, die dazu Plastikmüll verwerten. Darmbakterien als Problemlöser Akademikern der University of Edinburgh ist es gelungen, einen Weg für die Herstellung von Paracetamol zu finden, der völlig ohne Erdöl und CO2-Emssionen auskommt – die Fachzeitschrift „Nature Chemistry“ hatte zuerst darüber berichtet. Die Forscher fanden heraus, das eine bestimmte chemische Reaktion – der sogenannte Lossen-Abbau – auch unter Bedingungen herbeigeführt werden kann, die biokompatibel sind. Normalerweise wäre der klassische Lossen-Abbau für Escherichia coli-Darmbakterien (E. coli) zu hart, um sie für den Abbau von PET-Plastikmüll zu verwenden. Aber das Forscherteam aus Schottland fand heraus, dass Phosphat im Innern der Bakterien als Katalysator bei milden Temperaturen funktioniert. Das ermöglicht eine nicht-biochemische Reaktion in einer lebenden Zelle. Umwandlung in Paracetamol Wichtiger Bestandteil dieser Reaktion ist Terephthalsäure, die chemisch einem Grundbestandteil von PET ähnelt. Das inspirierte die Forscherinnen und Forscher dazu die Terephthalsäure aus der Hydrolyse alter PET-Flaschen zu gewinnen. Präparierte E.-coli-Stämme konnten daraufhin mithilfe der veränderten Terephthalsäure durch den Lossen-Abbau Para-Aminobenzoesäure (Paba) produzieren, den die E.-coli-Bakterien zum Wachstum benötigen. Nachdem das Forscherteam einem E.-coli-Stamm ein Gen aus einem Pilz und einem anderen Stamm ein weiters Gen aus einem Bakterium eingepflanzt hatten, fingen die aus diesen Genen abgeleiteten Enzyme an, Paba in Paracetamol umzuwandeln. Paracetamol-Ertrag von 92 Prozent Nachdem die schottischen Forscherinnen und Forscher den Prozess weiter optimierten, konnte der Paracetamol-Ertrag von anfänglich 29 Prozent auf 92 Prozent des ursprünglichen Substrats gesteigert werden. Dabei wird für den ganzen Prozess nur ein Gefäss benötigt, was für die industrielle Fertigung von Vorteil ist. Die kommerzielle Produktion des so gewonnenen Paracetamols ist nun der nächste Schritt. Er beweist das enorme Potenzial, welches die technische Biologie besitzt, um von fossilen Stoffen loszukommen, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu kreieren und nachhaltige Chemikalien zu entwickeln. Bildnachweis: Pixabay, 123081,...
Private Equity als Baustein der Altersvorsorge: Chancen und regulatorische Herausforderungen
Die Suche nach nachhaltiger Rendite bei gleichzeitigem Risikoausgleich prägt seit Jahren die strategische Ausrichtung institutioneller Altersvorsorgeeinrichtungen. In diesem Kontext gewinnt Private Equity zunehmend an Bedeutung. Anders als traditionelle Anlageformen bietet diese Assetklasse nicht nur die Möglichkeit, sich an der Entwicklung nicht-börsennotierter Unternehmen zu beteiligen, sondern auch langfristige Wertsteigerungspotenziale zu erschliessen, die klassische Rentenbausteine nicht bieten. Die langfristige Kapitalbindung, verbunden mit unternehmerischem Risiko, erfordert jedoch fundierte Anlagestrategien, tiefgreifende Marktkenntnisse und ein präzises regulatorisches Verständnis. Private Equity ist kein kurzfristiger Renditetreiber – sondern ein stabilisierendes Element mit langfristigem Horizont. Gerade Versorgungseinrichtungen, die über entsprechend planbare Kapitalflüsse verfügen, können von dieser Struktur profitieren. Doch neben den Chancen stellen komplexe gesetzliche Anforderungen eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Private Equity im Altersvorsorgeportfolio: Relevanz, Risikostruktur und Renditepotenzial Die Integration von Private Equity in ein Altersvorsorgeportfolio basiert auf der Erkenntnis, dass klassische Anlageklassen wie Anleihen und öffentlich gehandelte Aktien zunehmend an Attraktivität verlieren. Niedrige Zinsen und volatile Märkte haben den Druck erhöht, alternative Ertragsquellen zu erschliessen. Private Equity bietet in diesem Zusammenhang einen Zugang zu unternehmerischem Wachstum jenseits der Kapitalmärkte. Beteiligungen an innovativen, wachstumsstarken Unternehmen erlauben nicht nur attraktive Ertragschancen, sondern auch eine geringere Korrelation mit traditionellen Märkten – ein entscheidender Diversifikationsvorteil für Pensionskassen und Versorgungswerke. Allerdings erfordert dieser Zugang ein tiefes Verständnis für die spezifischen Risikostrukturen der Private-Equity-Branche. Illiquidität, lange Kapitalbindungsdauern und das Fehlen einer täglichen Bewertung verlangen von institutionellen Anlegern Geduld und ausgefeilte Strategien zur Mittelallokation. Die Risikoprämie, die Private Equity bietet, ist nicht bloss rechnerisch nachvollziehbar – sie zeigt sich langfristig im überdurchschnittlichen Performancepotenzial. Ein Renditerechner, der diese Anlageklasse berücksichtigt, muss Faktoren wie Vintage Year, Investitionszeitpunkt und Exit-Marktbedingungen dynamisch abbilden. Für Experten liegt die Herausforderung nicht im Zugang zum Kapitalmarkt, sondern in der strukturierten Bewertung nicht-börslicher Renditechancen bei gleichzeitigem Risikomanagement. Langfristige Kapitalbindung versus Flexibilitätsanforderungen: Ein Balanceakt für Versorgungseinrichtungen Institutionelle Altersvorsorgeeinrichtungen stehen vor der Aufgabe, langfristige Verpflichtungen gegenüber ihren Mitgliedern mit einem gleichzeitig ausreichenden Mass an Liquidität abzusichern. Genau hier liegt der kritische Punkt bei der Integration von Private Equity in die strategische Asset Allokation: Die Kapitalbindung ist langfristig und oftmals nur schwer planbar. Kapitalabrufe erfolgen nicht linear, Rückflüsse sind abhängig von Exit-Zeitpunkten der Fondsbeteiligungen – eine präzise Steuerung ist nur begrenzt möglich. Diese Eigenheiten fordern ein robustes Cashflow-Management, das mit klassischen Anlagen in kurzfristig liquide Werte kombiniert werden muss. Eine unzureichende Liquiditätsplanung kann im schlimmsten Fall zu einer Unterdeckung führen, wenn Zahlungsströme nicht zeitgerecht bedient werden können. Moderne Versorgungsträger reagieren auf diese Herausforderung mit modellierten Liquiditätsszenarien, der Einbindung von Secondaries oder der Auswahl von Fondsmanagern mit bewährten Rückflussstrategien. Die Balance zwischen langfristiger Rendite und operativer Flexibilität ist dabei essenziell. Sie lässt sich nur dann bewältigen, wenn Private Equity nicht isoliert, sondern als...
Nachhaltige Freiluftprojekte: Materialien, Energieversorgung und Umweltverträglichkeit im Fokus
Nachhaltige Freiluftprojekte gewinnen zunehmend an Bedeutung – sei es im Rahmen von Firmenevents, öffentlichen Veranstaltungen oder temporären Installationen im Aussenbereich. Der Anspruch, ökologische Verantwortung mit funktionaler Planung zu vereinen, erfordert nicht nur kreative Lösungen, sondern auch ein tiefes Verständnis für Materialien, Energieversorgung und Umweltverträglichkeit. Wer solche Vorhaben professionell umsetzt, steht vor komplexen Herausforderungen: Wie lassen sich Ressourcen schonen, ohne die Stabilität oder Sicherheit zu gefährden? Welche Infrastrukturkomponenten sind geeignet, um unabhängig von festen Versorgungsnetzen zu agieren? Und inwiefern können Umweltauflagen nicht nur erfüllt, sondern aktiv in ein nachhaltiges Gesamtkonzept integriert werden? Wir richten uns an erfahrene Planer, Projektverantwortliche und Entscheidungsträger, die nachhaltige Freiluftprojekte auf einem hohen fachlichen Niveau umsetzen wollen. Dabei werfen wir einen differenzierten Blick auf den gezielten Materialeinsatz, moderne Energieoptionen sowie gesetzliche und ökologische Rahmenbedingungen. Umweltschonende Materialien gezielt auswählen: Worauf es bei Bodenbelägen, Zelten und Mobiliar ankommt Bei der Auswahl der Materialien für nachhaltige Freiluftprojekte steht nicht nur die Langlebigkeit im Vordergrund, sondern auch deren Umweltbilanz über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Bodenbeläge sollten möglichst aus recycelbaren oder nachwachsenden Rohstoffen bestehen, die zugleich stabil genug für intensive Nutzung sind. Hier bieten sich etwa modulare Bodenplatten aus recyceltem Kunststoff oder Naturmaterialien wie Bambus an. Diese lassen sich mehrfach verwenden, sind leicht zu transportieren und verursachen in der Entsorgung kaum Probleme. Zelte und Überdachungen sollten aus PVC-freien, schadstoffarmen Membranen gefertigt sein. Polyester mit Beschichtungen auf Silikonbasis oder biologisch abbaubare Varianten können hier eine zukunftsfähige Alternative darstellen. Achten Sie bei der Auswahl des Mobiliars auf FSC-zertifiziertes Holz oder Aluminium mit hohem Recyclinganteil – beides Materialien, die nicht nur ökologisch überzeugen, sondern sich auch ästhetisch hochwertig in professionelle Settings integrieren lassen. Neben der Materialart spielt die Möglichkeit der Demontage und Wiederverwertung eine wichtige Rolle. Konstruktionen, die werkzeuglos montiert werden können, reduzieren nicht nur den Zeitaufwand, sondern auch das Risiko unnötiger Beschädigungen. Energieautarke Freiluftkonzepte: Mobile Lösungen für Strom- und Wasserversorgung im Gelände Eine nachhaltige Energieversorgung ist zentraler Bestandteil jeder verantwortungsvoll geplanten Outdoor-Veranstaltung. Mobile Solaranlagen zählen mittlerweile zur Basisausstattung vieler Projekte. Sie liefern emissionsfreien Strom und lassen sich flexibel skalieren – vom kleinen Panel auf dem Technikzelt bis zur grossflächigen Solarfeldlösung für Bühnen und Cateringbereiche. Kombiniert mit leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akkus, lässt sich eine durchgängige Versorgung auch bei wechselhafter Sonneneinstrahlung gewährleisten. Für die temporäre Wasserversorgung empfiehlt sich der Einsatz mobiler Filtersysteme. Diese ermöglichen es, vorhandenes Regen- oder Brunnenwasser aufzubereiten und für Sanitäranlagen oder Reinigungszwecke nutzbar zu machen. Der Vorteil liegt nicht nur in der Ressourcenschonung, sondern auch in der Unabhängigkeit von externen Leitungsnetzen. Biokraftstoffbetriebene Generatoren bieten eine ergänzende Option, sollten aber ausschliesslich als Rückfallebene bei extremen Verbrauchsspitzen zum Einsatz kommen. Durch intelligente Laststeuerung – beispielsweise via Smart Grid-Komponenten – lassen sich Verbrauchsprofile optimieren und überschüssige Energie...
Paiement mobile: quels appareils sont durables?
Dans un commerce de détail en pleine mutation, le paiement mobile est längst plus qu’un simple atout technologique – il devient une nécessité stratégique. Les attentes des clients évoluent, tout comme les exigences en matière de rapidité, de sécurité et de flexibilité. Pour les détaillants et les commerçants de proximité, la question centrale n’est plus « Faut-il proposer le paiement mobile ? », mais bien « Quels appareils garantissent une performance durable à long terme ? ». Entre innovations techniques et nouvelles normes, le choix du terminal adéquat peut faire la différence entre un système adaptable et un outil obsolète. Dans ce contexte, le terminal de paiement suisse figure souvent parmi les références, alliant précision, conformité et évolutivité. Mais quelles sont réellement les solutions à considérer aujourd’hui pour rester compétitif demain ? Aperçu technologique : quels terminaux mobiles dominent actuellement le marché ? L’écosystème des terminaux mobiles s’est considérablement diversifié au cours des dernières années. Parmi les modèles les plus performants, on retrouve des appareils tout-en-un combinant lecteur de carte, imprimante et système d’exploitation Android. Des marques comme Ingenico, Verifone et SumUp proposent des solutions particulièrement adaptées aux besoins du commerce de détail. Le terminal de paiement suisse, souvent loué pour sa robustesse et sa conformité aux normes locales, offre une compatibilité optimale avec les systèmes bancaires helvétiques. Les terminaux modernes misent sur la connectivité 4G ou Wi-Fi, l’autonomie longue durée et l’ergonomie tactile. De plus, certains modèles permettent la personnalisation de l’interface utilisateur ou l’intégration d’applications spécifiques à la gestion des ventes. Le support des principales technologies de paiement – NFC, EMV, Apple Pay, Google Pay – est aujourd’hui indispensable. Le critère décisif réside souvent dans la capacité de l’appareil à s’intégrer dans un écosystème omnicanal et à évoluer par mises à jour logicielles. Cela permet aux commerçants de rester réactifs face aux nouvelles habitudes de consommation, sans devoir renouveler constamment leur matériel. Normes de sécurité en mutation : à quoi faut-il veiller avec les nouveaux appareils ? La sécurité des paiements est une priorité absolue dans l’environnement réglementaire actuel. Chaque terminal mobile doit être conforme à la norme PCI PTS (Payment Card Industry PIN Transaction Security), garantissant la protection des données sensibles. Mais cette exigence de base ne suffit plus. Les nouveaux appareils doivent aussi pouvoir chiffrer les transactions de bout en bout, détecter les intrusions physiques et permettre la gestion sécurisée à distance via des plateformes de monitoring. Les autorités financières, notamment en Suisse, imposent une rigueur accrue quant à la traçabilité des paiements et à la conformité aux standards de la FINMA. Un terminal de paiement suisse bien conçu intègre ces impératifs en natif et bénéficie d’un suivi logiciel régulier. Par ailleurs,...